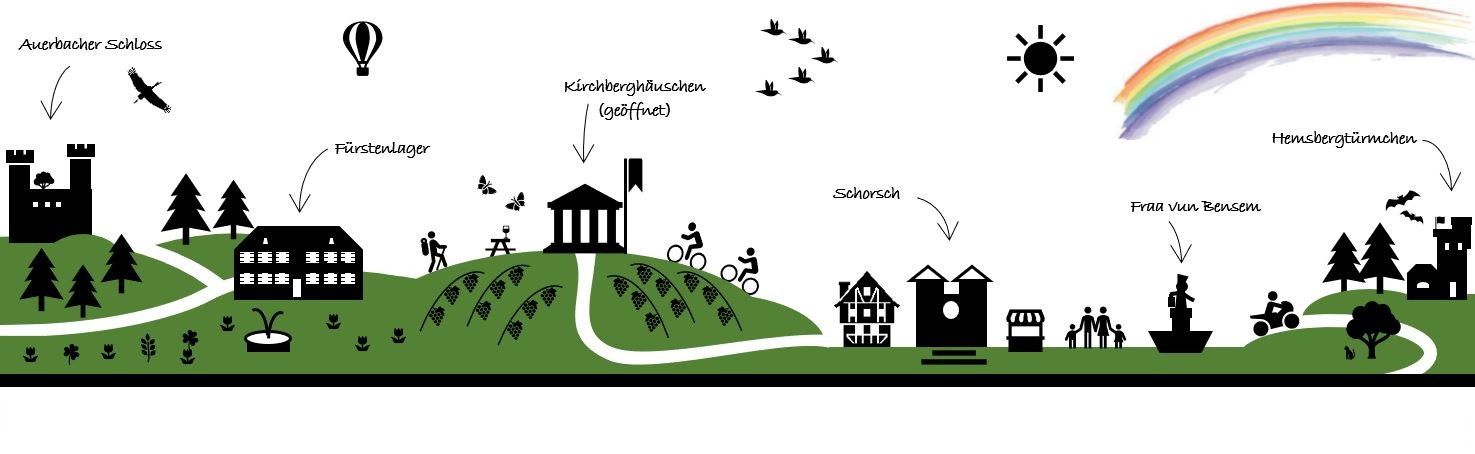Dieser Blog läuft mit Neugier, Kaffee und einer guten Portion Idealismus.
Ich schreibe, recherchiere, gestalte und pflege das alles in meiner Freizeit –
damit regionale Themen, Engagement und gute Geschichten sichtbar bleiben.
Wenn dir das gefällt, freue ich mich über eine kleine Unterstützung.
Jeder Beitrag hilft, dass ich diesen Blog mit der nötigen Zeit und Sorgfalt
weiterführen kann.
Danke dir!
Veröffentlicht am 5. Januar 2026
Zuletzt aktualisiert am 5. Januar 2026
Für wen & wofür geeignet: Kommunalpolitisch Interessierte, Planungs- und Umweltengagierte sowie Entscheidungsträger:innen – als vertiefende Analyse wohnungspolitischer Steuerungsinstrumente, zur Vorbereitung fachlicher Diskussionen und als Hintergrund für die Bewertung kommunaler Entwicklungsstrategien.
© Michael K. Kärchner
Es gibt keinen Mangel an Raum – es gibt einen Mangel an politischer Konsequenz bei der Nutzung vorhandener Räume. Während Städte und Kommunen im Außenbereich neue Baugebiete ausweisen und auf die „grüne Wiese“ setzen, bleiben wertvolle Flächen im Inneren vielfach ungenutzt. In Hessen wurde 2025 ein Gesetz gegen spekulativen Wohnungsleerstand beschlossen. Dieses adressiert ein reales Problem, greift jedoch nur dort, wo Fehlentwicklungen bereits sichtbar sind. Die strukturelle Ursache – die unzureichende Aktivierung vorhandener Bestandsflächen – bleibt davon weitgehend unberührt.
Das strukturelle Paradox
Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum zählt seit Jahren zu den zentralen sozialen Spannungen moderner Stadtgesellschaften. In nahezu allen größeren Städten übersteigt die Nachfrage nach Wohnungen das verfügbare Angebot deutlich; Mietpreise steigen, Wohnungssuche wird zur existenziellen Frage, Wohnortwechsel markieren für viele Haushalte einen tiefen Einschnitt in ihre Lebensplanung. Parallel dazu verfestigt sich ein zweiter, scheinbar davon unabhängiger Trend: der weiterhin hohe Verbrauch unbebauter Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke, insbesondere im Außenbereich der Städte.
Politisch werden diese beiden Entwicklungen meist getrennt verhandelt. Wohnraummangel gilt als Problem unzureichender Bautätigkeit und wird entsprechend mit Neubauprogrammen beantwortet. Flächenverbrauch hingegen wird dem Naturschutz zugeordnet, flankiert von Ausgleichsmaßnahmen, Zielwerten oder langfristigen Reduktionsstrategien. Diese Trennung ist bequem – und sie ist analytisch unhaltbar. Sie verdeckt einen Zusammenhang, der in der raumwissenschaftlichen Forschung seit Jahren beschrieben wird, in der politischen Praxis jedoch kaum konsequent umgesetzt ist: Der Wohnraummangel ist in weiten Teilen kein Flächenproblem, sondern ein Nutzungsproblem.
Deutschland leidet weder an einem absoluten Mangel an Raum noch an fehlenden baulichen Potenzialen. Was fehlt, ist die systematische Bereitschaft, vorhandene Strukturen – Gebäude, Grundstücke und die dazugehörige Infrastruktur – gegenüber neuen Eingriffen zu priorisieren. Innenentwicklung wird in Leitbildern, Koalitionsverträgen und Sonntagsreden regelmäßig beschworen, im planerischen Alltag jedoch häufig nachrangig behandelt. Neubau im Außenbereich bleibt die Regel, die Aktivierung des Bestands die Ausnahme.
Innenentwicklung: theoretisches Potenzial, politisch unterschätzt
Studien des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung sowie des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung kommen seit Langem zu einem übereinstimmenden Ergebnis: Allein auf innerstädtischen Brachen, Konversionsflächen und Baulücken ließe sich – rein rechnerisch – ein Wohnraumpotenzial von bis zu drei Millionen Wohneinheiten erschließen. Gemeint sind dabei Flächen innerhalb bestehender Siedlungsstrukturen, die infrastrukturell angebunden sind, jedoch baulich nicht oder nur unzureichend genutzt werden.
Diese Zahl ist ausdrücklich kein Bauprogramm und auch kein politisches Versprechen. Sie beschreibt ein theoretisches Flächen- und Nutzungspotenzial, keine kurzfristig realisierbare Bauleistung. Ihre eigentliche Bedeutung liegt an anderer Stelle: Sie markiert die Größenordnung dessen, was innerhalb bestehender Stadtstrukturen grundsätzlich möglich wäre, bevor neue Flächen in Anspruch genommen werden.
Entscheidend ist dabei weniger die absolute Höhe des Potenzials als das, was es nicht umfasst. In diesen Berechnungen sind weder leerstehende Wohnungen noch leerstehende Ein- oder Zweifamilienhäuser enthalten, ebenso wenig die Umnutzung von Büro- oder Gewerbeimmobilien. Mit anderen Worten: Das ausgewiesene Innenentwicklungspotenzial bildet nicht einmal den gesamten Bestand ab, sondern lediglich einen Teil ungenutzter oder untergenutzter Flächen im Innenbereich. Der tatsächlich vorhandene Spielraum ist damit größer, als es die oft zitierte Zahl bereits vermuten lässt.
Innenentwicklung: Größenordnung des Potenzials
Nach Untersuchungen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) und des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung (IÖR) könnten allein durch die Aktivierung innerstädtischer Brachen, Konversionsflächen und Baulücken bis zu drei Millionen zusätzliche Wohneinheiten entstehen.
In diesen Berechnungen nicht enthalten sind leerstehende Wohnungen, Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Umnutzungspotenziale von Büro- und Gewerbeimmobilien. Das tatsächliche Nutzungspotenzial im Bestand liegt damit deutlich höher.
Quelle: BBSR / IÖR, Innenentwicklungspotenziale deutscher Städte
Flächenverbrauch: politisch bekannt, praktisch folgenlos
Demgegenüber steht der weiterhin hohe Flächenverbrauch. Daten des Umweltbundesamtes zeigen, dass in Deutschland nach wie vor täglich erhebliche Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke in Anspruch genommen werden. In einzelnen Bundesländern, etwa in Nordrhein-Westfalen, lag der Wert über Jahre hinweg im Bereich von rund zehn Hektar pro Tag. Trotz politischer Zielmarken, allen voran des seit Langem formulierten 30-Hektar-Ziels auf Bundesebene, ist ein struktureller Rückgang bislang nicht erreicht.
Der überwiegende Teil dieses Flächenverbrauchs betrifft den Außenbereich. Landwirtschaftliche Nutzflächen, Grünland und naturnahe Räume werden zu Baugebieten, oft am Stadtrand oder im Umland wachsender Städte. Die ökologischen Folgen sind hinreichend bekannt: Verlust von Biodiversität, Beeinträchtigung von Bodenfunktionen, zusätzliche Verkehrsströme. Weniger beachtet wird hingegen die ökonomische Dimension. Neubaugebiete erfordern neue Straßen, Leitungen, soziale Infrastruktur und langfristige Unterhaltung. Gleichzeitig bleiben bestehende Netze im Innenbereich unterausgelastet – ein strukturelles Ineffizienzproblem, das kommunale Haushalte dauerhaft belastet.
Flächenverbrauch im Außenbereich
Nach Angaben des Umweltbundesamtes werden in Deutschland weiterhin täglich mehrere Dutzend Hektar Fläche für Siedlungs- und Verkehrszwecke in Anspruch genommen. In einzelnen Bundesländern – etwa Nordrhein-Westfalen – lag der Wert über Jahre hinweg bei rund zehn Hektar pro Tag.
Trotz des politisch formulierten 30-Hektar-Ziels ist bislang kein struktureller Rückgang erreicht. Der überwiegende Teil der Flächen geht im Außenbereich verloren – mit langfristigen ökologischen und kommunalfinanziellen Folgekosten.
Quelle: Umweltbundesamt (UBA), Flächeninanspruchnahme in Deutschland
Leerstand: statistisch vorhanden, politisch relativiert
Vor diesem Hintergrund erhält auch die Debatte um Wohnungsleerstand eine andere Qualität. Der Zensus 2022 weist bundesweit mehrere Millionen leerstehende Wohnungen aus; für Hessen werden mehr als 120.000 Wohnungen genannt, von denen über die Hälfte länger als ein Jahr ungenutzt ist. Die politische Interpretation dieser Zahlen schwankt erheblich. Kritiker verweisen auf normale Fluktuation durch Umzüge, Renovierungen oder Eigentümerwechsel. Befürworter eines stärkeren Eingreifens sehen darin den Beleg für systematischen Leerstand.
Beide Lesarten greifen zu kurz. Entscheidend ist nicht die absolute Leerstandsquote, sondern die Kombination aus Dauer, Lage und Kontext. Langfristig ungenutzter Wohnraum in angespannten Märkten ist kein zufälliges Nebenprodukt, sondern Ausdruck struktureller Fehlanreize. Spekulatives Abwarten, fehlende Aktivierung des Bestands und die geringen Kosten des Nicht-Nutzens erzeugen ein Umfeld, in dem Leerstand rationales Verhalten sein kann – volkswirtschaftlich jedoch ineffizient bleibt.
Wohnungsleerstand: Dauer ist entscheidend
Der Zensus 2022 weist für Hessen über 120.000 leerstehende Wohnungen aus. Mehr als die Hälfte dieser Wohnungen stand länger als ein Jahr leer. Damit handelt es sich nicht um kurzfristige Umzugs- oder Renovierungsleerstände.
In angespannten Wohnungsmärkten gilt langfristiger Leerstand als strukturelles Problem, da er Wohnraum dem Markt entzieht, während gleichzeitig öffentliche Infrastruktur dauerhaft vorgehalten wird.
Quelle: Zensus 2022, Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Das hessische Leerstandsgesetz: Eingriff oder Korrektur?
Mit dem im November 2025 beschlossenen Gesetz gegen spekulativen Wohnungsleerstand hat Hessen einen Schritt vollzogen, den andere Bundesländer bereits vor Jahren gegangen sind. Neu ist weniger der Gedanke als die Konsequenz, mit der er nun verfolgt wird. Leerstand wird nicht länger ausschließlich als statistische Randgröße oder moralisch aufgeladenes Ärgernis behandelt, sondern erstmals ausdrücklich als ordnungsrechtlich relevanter Zustand in angespannten Wohnungsmärkten definiert.
Der rechtliche Kern des Gesetzes ist dabei vergleichsweise klar gefasst. Kommunen, die als Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt ausgewiesen sind, erhalten die Möglichkeit, längerfristigen Leerstand zu begrenzen und genehmigungspflichtig zu machen. Wohnungen, die über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten ohne triftigen Grund ungenutzt bleiben, können meldepflichtig werden. Wird eine Genehmigung nicht erteilt oder fehlt sie, sieht das Gesetz empfindliche Sanktionen vor. Der Gesetzgeber formuliert diesen Ansatz ausdrücklich als Lenkungsinstrument, nicht als bloßen Appell an gesellschaftliche Verantwortung.
Juristisch ist dieser Eingriff eng gerahmt. Das Gesetz richtet sich ausdrücklich nicht gegen Leerstände, die aus nachvollziehbaren Gründen entstehen. Umzüge, Sanierungen, familiäre Übergänge oder Erbauseinandersetzungen bleiben ebenso geschützt wie nachweislich erfolglose Vermietungsbemühungen oder wirtschaftlich unzumutbare Maßnahmen. Die Schwelle zum ordnungswidrigen Verhalten ist bewusst hoch angesetzt, um die Verhältnismäßigkeit zu wahren und Eigentumsrechte nicht pauschal in Frage zu stellen. In dieser Ausgestaltung folgt das hessische Gesetz etablierten Regelungen anderer Länder und stützt sich auf eine gefestigte verwaltungsgerichtliche Praxis.
Politisch jedoch markiert das Gesetz eine Verschiebung, die über seinen juristischen Gehalt hinausweist. Wohnen wird nicht mehr ausschließlich als private Dispositionsmasse verstanden, sondern explizit als Teil öffentlicher Daseinsvorsorge. Diese Neubewertung ist es, an der sich die Kontroverse entzündet. Für die einen ist sie überfällig, für die anderen ein gefährlicher Präzedenzfall.
Die Befürworter argumentieren, dass Eigentum dort an Grenzen stoße, wo Wohnraum dauerhaft der gesellschaftlichen Nutzung entzogen werde, während gleichzeitig öffentliche Infrastruktur vorgehalten werde. Straßen, Leitungen, Schulen und öffentlicher Verkehr werden für bewohnte Quartiere geplant und finanziert, nicht für leerstehende Gebäude. Langfristiger Leerstand externalisiere Kosten, während mögliche Wertsteigerungen privatisiert würden. In angespannten Märkten sei es daher legitim, korrigierend einzugreifen.
Die Gegner hingegen sehen genau an dieser Stelle den Einstieg in eine schleichende Umdeutung des Eigentumsbegriffs. Sie warnen vor zusätzlicher Bürokratie, vor einem Generalverdacht gegenüber Eigentümerinnen und Eigentümern und vor einer politischen Symbolik, die suggeriere, Wohnraummangel lasse sich primär durch Ordnungspolitik beheben. Neue Wohnungen, so das zentrale Gegenargument, entstünden nicht durch Meldepflichten oder Bußgeldandrohungen, sondern durch Bautätigkeit und Investitionsanreize.
Beide Positionen operieren mit zutreffenden Beobachtungen. Und doch verfehlen sie jeweils einen entscheidenden Punkt. Das Leerstandsgesetz ist weder der große wohnungspolitische Befreiungsschlag noch der Beginn eines enteignenden Staates. Es ist ein Korrekturinstrument innerhalb eines Systems, das über Jahre hinweg vor allem eines begünstigt hat: das Nichtstun im Bestand. Seine Wirkung entfaltet es nicht isoliert, sondern nur im Zusammenspiel mit kommunaler Praxis.
Kommunale Realität: Warum Städte handeln könnten – und es oft nicht tun
Ob ein Leerstandsgesetz Wirkung entfaltet, entscheidet sich nicht im Landtag, sondern im Rathaus. Die hessische Regelung ist bewusst als Kann-Instrument konzipiert. Sie verpflichtet keine Kommune zum Handeln, sondern eröffnet Handlungsspielräume. Genau an dieser Stelle beginnt jedoch das eigentliche Problem. Besonders deutlich wird dies bei der praktischen Umsetzung. Die Identifikation ungenutzter Flächen oder unterbelegter Gebäude ist nur der erste Schritt. Die eigentliche Herausforderung liegt in der Kontaktaufnahme mit Eigentümerinnen und Eigentümern, häufig älteren Menschen, deren Lebensrealität nicht durch planerische Kennzahlen abgebildet werden kann. Innenentwicklung ist deshalb weniger eine technische als eine soziale Aufgabe. Sie erfordert Beratung, Alternativen und Vertrauen – keine pauschalen Eingriffe.
Die Aktivierung des Bestands ist komplex, konfliktträchtig und administrativ aufwendig. Neubau im Außenbereich erscheint demgegenüber als der vermeintlich einfachere Weg. Ein Blick auf Städte wie München, Freiburg, Tübingen oder Ulm zeigt, dass Innenentwicklung dort vorankommt, wo sie politisch priorisiert und institutionell unterlegt wird. In München wurden Leerstände frühzeitig systematisch erfasst und Baulücken aktiviert, weniger durch Sanktionen als durch Beratung, Anreize und klar definierte Verfahren. Freiburg und Tübingen haben Innenentwicklung planerisch zur Regel erklärt und Neubau im Außenbereich entsprechend restriktiv behandelt. Ulm wiederum hat Flächenmanagement und Wohnraumpolitik früh miteinander verzahnt und so Nutzungskonflikte reduziert, bevor sie politisch eskalierten.
Besonders instruktiv ist der Blick nach Wien. Die österreichische Hauptstadt verfolgt seit Jahren eine aktive Boden- und Wohnungspolitik, in der Leerstand, Baulücken und Nachverdichtung nicht isoliert, sondern als zusammenhängende Steuerungsaufgabe betrachtet werden. Nutzungsauflagen, kommunaler Bodenbesitz und sozialer Wohnungsbau greifen ineinander, getragen von einer Verwaltung, die Innenentwicklung nicht als zusätzliche Belastung, sondern als zentrale Aufgabe versteht. Der gemeinsame Nenner dieser Beispiele ist nicht Ideologie, sondern Konsequenz. Innenentwicklung ist arbeitsintensiv. Sie erfordert Verhandlungen mit Eigentümerinnen und Eigentümern, detaillierte Planung und ein hohes Maß an Konfliktmanagement im Quartier. Neubau im Außenbereich ist demgegenüber oft schneller, sichtbarer und politisch weniger konfliktträchtig. Gerade deshalb wird er bevorzugt – obwohl er langfristig höhere ökologische und finanzielle Kosten verursacht.
Kommunen scheitern an dieser Stelle selten aus bösem Willen. Sie bewegen sich vielmehr in einem Spannungsfeld aus begrenzten personellen Ressourcen, komplexen Eigentumsverhältnissen und politisch sensiblen Entscheidungsprozessen. Die Aktivierung von Baulücken und untergenutztem Wohnraum erfordert Zeit, Kommunikation und konfliktfähige Verfahren – Anforderungen, die im kommunalen Alltag häufig gegenüber schneller realisierbaren Neubauprojekten zurückstehen.
Bensheim: formale Nicht-Betroffenheit und faktische Relevanz
Bensheim gilt nach aktueller Landesbewertung nicht als Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt. Formal greift das hessische Leerstandsgesetz damit nicht. Diese Feststellung ist juristisch korrekt – sie wird jedoch problematisch, sobald sie als Argument gegen eine inhaltliche Auseinandersetzung herangezogen wird. Denn sie verwechselt rechtliche Zuständigkeit mit planerischer Verantwortung.
Die Kriterien, nach denen Wohnungsmärkte als „angespannt“ klassifiziert werden, sind notwendigerweise grob. Sie reagieren träge auf lokale Entwicklungen, glätten räumliche Unterschiede und bilden Durchschnittswerte ab. Für die kommunale Realität bedeutet dies vor allem eines: rechtliche Entlastung, nicht planerische Entwarnung. Dass bezahlbarer Wohnraum in Bensheim knapp ist, wird politisch kaum bestritten. Ebenso wenig, dass es leerstehende Wohnungen gibt. Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob das Leerstandsgesetz formal anwendbar ist, sondern ob die ihm zugrunde liegende Logik für die Stadt relevant wäre.
Auffällig ist dabei weniger ein grundsätzlicher Widerspruch gegen das Instrument des Leerstandsgesetzes als ein Ausweichen vor seiner Konsequenz. Kaum jemand bestreitet, dass langfristiger Leerstand problematisch ist. Kaum jemand bestreitet, dass Neubau im Außenbereich ökologische und finanzielle Folgekosten erzeugt. Und doch bleibt der Schritt von der Erkenntnis zur Strategie aus. Zwischen Analyse und Handlung öffnet sich eine Lücke, die politisch nicht benannt, aber praktisch wirksam wird.
Stattdessen dominiert eine Haltung der Vorsicht. Man wolle keine zusätzliche Bürokratie aufbauen, keine Eigentümer verunsichern, keine Verwaltung überfordern. All das sind legitime Erwägungen. Doch sie verdecken eine zentrale Leerstelle: Es fehlt eine belastbare Bestandsaufnahme. Ohne eine verbindliche, regelmäßig aktualisierte und politisch genutzte Bestandsaufnahme von Leerstand, Nutzungsdauer, Lage und Kontext bleibt jede Entscheidung spekulativ – im wörtlichen Sinne. Dabei mangelt es nicht grundsätzlich an Daten oder technischen Möglichkeiten, sondern an deren institutionalisierter Nutzung. Die Zurückhaltung entsteht weniger aus Unwissen als aus der fehlenden Übersetzung vorhandener Informationen in verbindliche politische Strategien.
Nach fachlichen Hinweisen aus der kommunalen Praxis gibt es beim Amt für Bodenmanagement ein bestehendes Modell, das Kommunen – gegen geringes Entgelt – zur Verfügung steht. Dieses Modell erfasst Baulücken im Innenbereich und kann zugleich Hinweise auf die Nutzung von Wohnraum liefern. Letzteres wird erreicht, indem Katasterdaten mit den Daten des Einwohnermeldeamtes abgeglichen werden. Dadurch kann sichtbar werden, ob in großen Wohngebäuden nur eine oder zwei Personen gemeldet sind – und ebenso, ob es Wohnungen gibt, bei denen überhaupt niemand gemeldet ist.
Entscheidend ist anschließend weniger die Technik als das, was danach kommt: Die eigentliche Herausforderung beginnt bei der Kontaktaufnahme mit den betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümern – häufig älteren Menschen – und bei der Frage, ob und wie man tragfähige, sozial akzeptable Alternativen anbieten kann. Innenentwicklung erweist sich damit nicht als reines Daten- oder Planungsproblem, sondern als kommunikative und soziale Aufgabe.
Bensheim ist dabei kein Fall „ohne Druck“. Im Gegenteil: Gerade als Stadt mit regionaler Funktion und spürbarem Entwicklungs- und Flächendruck wird Bensheim in übergeordneten Planungen ausdrücklich adressiert, inklusive konkreter Flächenkontingente und der Debatte um die Rolle als Entlastungskommune. Damit wird die formale Nicht-Einstufung als „angespannter Wohnungsmarkt“ schnell zur bequemen Begründung, strukturelle Fragen zu vertagen. Diese Vertagung stabilisiert jedoch bestehende Fehlentwicklungen, statt sie zu korrigieren.
Baulücken: Der übersehene Hebel der Innenentwicklung
Das hessische Leerstandsgesetz erfasst ausschließlich bestehenden Wohnraum. Unbebaute Grundstücke im Innenbereich – sogenannte Baulücken – fallen nicht darunter, obwohl sie vielfach seit Jahren erschlossen, infrastrukturell angebunden und planungsrechtlich bebaubar sind.
Gerade für Mittelstädte wie Bensheim stellen Baulücken ein zentrales, bislang kaum genutztes Innenentwicklungspotenzial dar. Ihre Nicht-Nutzung ist häufig weniger technisch als strategisch begründet – etwa durch spekulatives Abwarten oder fehlende kommunale Aktivierung.
Ein kommunal verankertes Baulücken- und Innenentwicklungskataster ist kein Eingriff in Eigentumsrechte, sondern eine institutionalisierte Form der Bestandskenntnis. Entscheidend ist dabei weniger die technische Erhebung als ihre Verstetigung: Transparenz entsteht erst dann, wenn Daten regelmäßig aktualisiert, politisch ausgewertet und in strategische Entscheidungen eingebunden werden. Ohne diese Verbindlichkeit bleiben selbst vorhandene Erhebungen folgenlos.
Wer hat wo recht – und wo wird systematisch zu kurz gedacht?
Die wohnungspolitische Debatte um Flächenverbrauch, Leerstand und Innenentwicklung leidet weniger an ideologischer Polarisierung als an struktureller Verkürzung. Nahezu alle beteiligten Akteure benennen reale Probleme, häufig sogar präzise. Was fehlt, ist die Bereitschaft, aus diesen Diagnosen die notwendigen Konsequenzen zu ziehen – insbesondere dort, wo sie unbequem werden.
Die hessische Landesregierung hat recht, wenn sie dauerhaften Wohnungsleerstand in angespannten Märkten nicht länger als hinnehmbar betrachtet. Die ordnungsrechtliche Aufwertung des Leerstands ist kein willkürlicher Eingriff, sondern eine Reaktion auf jahrelange politische Untätigkeit gegenüber einem bekannten Missstand. Wer öffentliche Infrastruktur in Anspruch nimmt, ohne Wohnraum bereitzustellen, externalisiert Kosten und entzieht sich zugleich jeder gesellschaftlichen Verantwortung. Dies zu korrigieren ist legitim und ordnungspolitisch begründbar. Zugleich bleibt die Landespolitik hinter ihrem eigenen Anspruch zurück, wenn sie das Instrument isoliert betrachtet. Ein Leerstandsgesetz ohne verbindliche Flächen- und Innenentwicklungsstrategie wirkt reaktiv. Es greift dort ein, wo Fehlentwicklungen bereits sichtbar sind, ohne die strukturellen Bedingungen zu verändern, unter denen sie entstehen.
Die FDP wiederum trifft einen wahren Kern, wenn sie vor Bürokratisierung und symbolischer Politik warnt. Wohnraummangel lässt sich nicht durch Verwaltungsakte beheben, und Eigentum ist kein nachrangiges Gut, sondern ein konstitutiver Bestandteil einer freiheitlichen Ordnung. Diese Argumentation verliert jedoch an Überzeugungskraft, sobald sie die systemischen Realitäten ausblendet. Die Kosten des Nicht-Nutzens sind real, ebenso die Fehlanreize eines Systems, das Leerstand faktisch folgenlos lässt. Die Verteidigung des Status quo wird so zur Verteidigung eines Arrangements, das volkswirtschaftlich ineffizient und sozial regressiv wirkt.
Die Grünen haben recht, wenn sie den Zusammenhang zwischen Flächenverbrauch, Innenentwicklung und Wohnraumpolitik in den Mittelpunkt rücken. Die ökologische Dimension ist kein Nebenaspekt, sondern Kernfrage einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung. Neubau im Außenbereich verschärft Zielkonflikte, die planerisch und ökologisch seit Langem bekannt sind. Gleichzeitig bleibt auch diese Position häufig abstrakt. Innenentwicklung wird eingefordert, aber selten mit der notwendigen institutionellen Konsequenz unterlegt. Ohne klare Priorisierung, ohne ausreichende personelle Ausstattung der Kommunen und ohne Eingriffe in bestehende Anreizstrukturen bleibt der Verweis auf Nachhaltigkeit normativ, nicht operativ.
Die Kommunen schließlich stehen im Zentrum des Problems – und zugleich zwischen allen Ebenen. Sie verfügen über die planungsrechtlichen Instrumente, aber häufig nicht über die Ressourcen, sie konsequent einzusetzen. Sie kennen Leerstände, vermeiden jedoch deren systematische Erfassung. Sie bekennen sich zur Innenentwicklung, setzen aber neue Baugebiete um, weil diese kurzfristig einfacher, sichtbarer und politisch weniger konfliktträchtig sind. In der Summe entsteht eine Situation, in der alle Akteure in Teilaspekten recht haben – und gemeinsam dennoch scheitern. Nicht, weil es an Analyse mangelt, sondern weil diese Analyse oft folgenlos bleibt.
Schlussfolgerung: Nicht fehlende Instrumente, sondern fehlende Konsequenz
Der Zusammenhang zwischen Flächenverbrauch im Außenbereich und Leerstand im Innenbereich ist seit Jahren gut belegt. Studien von BBSR und IÖR sowie amtliche Daten wie der Zensus 2022 zeigen, dass erhebliche Potenziale innerhalb bestehender Siedlungsstrukturen vorhanden sind. Dass diese bislang nur begrenzt genutzt werden, liegt weniger an fehlendem Wissen als an der Frage, welche Instrumente politisch tatsächlich priorisiert werden.
Wohnraumpolitik scheitert dabei selten am absoluten Mangel an Bautätigkeit, sondern häufig an der Gewichtung von Handlungsoptionen. Neubau im Außenbereich ist vergleichsweise leicht planbar und schnell sichtbar, während Innenentwicklung zeitaufwendig, konfliktanfällig und administrativ anspruchsvoll ist. Diese strukturellen Unterschiede beeinflussen politische Entscheidungen – oft zugunsten kurzfristig realisierbarer Lösungen.
Das hessische Leerstandsgesetz kann in diesem Kontext ein sinnvolles Korrektiv darstellen. Nicht als Ersatz für Wohnungsbau, sondern als Signal, dass langfristige Nicht-Nutzung in angespannten Märkten nicht folgenlos bleibt. Seine Wirkung entfaltet es jedoch nur dann, wenn es in eine breitere Strategie eingebettet ist, die Leerstand, Baulücken und Flächenverbrauch gemeinsam in den Blick nimmt. Die entscheidende Frage ist daher weniger, ob weitere Instrumente benötigt werden, sondern wie konsequent vorhandene genutzt werden. Innenentwicklung müsste stärker zur planerischen Leitlinie werden, während Neubau im Außenbereich einer klaren Begründung bedarf. Dafür benötigen Kommunen nicht nur rechtliche Möglichkeiten, sondern auch personelle Ressourcen, klare Verfahren und politischen Rückhalt.
Das Beispiel Bensheim zeigt, wie schnell formale Nicht-Betroffenheit dazu führen kann, strukturelle Fragen aufzuschieben. Vorsorge bedeutet jedoch, vorhandene Potenziale frühzeitig zu erkennen und strategisch zu nutzen – nicht erst unter akutem Druck. Insgesamt wird deutlich: Die wohnungspolitischen Herausforderungen unserer Zeit entstehen weniger aus gegensätzlichen Interessen als aus der Trennung von Themen, die funktional zusammengehören. Eine nachhaltige Wohnraumpolitik setzt dort an, wo vorhandene Räume ernst genommen, priorisiert und aktiv gestaltet werden.
Veröffentlicht im: Bergsträßer Anzeiger, Ausgabe vom 31. Dezember 2025
Leserforum zum Thema „Uneinigkeit über neues Leerstandsgesetz in Bensheim“
Der Artikel um das neue hessische Leerstandsgesetz in der Bensheimer Stadtverordnetenversammlung zeichnet die unterschiedlichen Positionen sehr differenziert nach. Gerade deshalb lohnt ein Blick auf das, was in der Diskussion zwar benannt, aber noch nicht zu Ende gedacht wurde.
Richtig ist: Das hessische Leerstandsgesetz gilt derzeit formal nicht für Bensheim. Ebenso richtig ist aber auch, dass formale Nicht-Betroffenheit keine inhaltliche Entwarnung bedeutet.
Dass bezahlbarer Wohnraum knapp ist und gleichzeitig Wohnungen leer stehen, wird in der politischen Debatte kaum bestritten, parteiübergreifend. Der Kernkonflikt liegt weniger im „Ob“, sondern im „Wie“ des Umgangs mit diesem Widerspruch.
Die Warnungen vor Bürokratie, Eigentumseingriffen und symbolischer Politik sind ernst zu nehmen. Ein Leerstandsgesetz schafft keine neuen Wohnungen. Ebenso zutreffend ist jedoch der Hinweis, dass langfristiger Leerstand kein rein privates Phänomen ist, wenn öffentliche Infrastruktur dauerhaft vorgehalten wird und gleichzeitig Wohnraumbedarf besteht. Beides schließt sich nicht aus, sondern beschreibt einen Zielkonflikt, der sachlich bearbeitet werden müsste.
Was in der bisherigen Diskussion auffällig fehlt, ist der Blick auf die strukturelle Ebene. Leerstand ist nur ein Teil des Problems. Unbebaute, erschlossene Grundstücke im Innenbereich – sogenannte Baulücken – bleiben ebenfalls seit Jahren ungenutzt, ohne systematisch erfasst oder politisch adressiert zu werden.
Hier geht es nicht um Sanktionen, sondern um Transparenz und belastbare Planungsgrundlagen. Ein Baulücken- oder Innenentwicklungskataster wäre kein Eingriff in Eigentumsrechte, sondern ein notwendiger erster Schritt, um überhaupt fundiert über vorhandene Potenziale sprechen zu können.
Die Vertagung der Debatte in die Ausschüsse ist kein Skandal. Sie wird jedoch dann problematisch, wenn sie zur dauerhaften Verschiebung wird. Wohnraumpolitik scheitert selten am Erkenntnismangel, sondern häufig an fehlender Konsequenz. Wer erst handelt, wenn rechtlicher Zwang entsteht, hat die Steuerung längst aus der Hand gegeben.
Vielleicht liegt die eigentliche Chance dieser Debatte nicht im Für oder Wider eines einzelnen Gesetzes, sondern darin, Innenentwicklung endlich ernst zu nehmen, als strategische Aufgabe und nicht nur als wohlklingendes Leitbild.
Bensheim könnte hier früher anfangen als andere Städte. Die Voraussetzungen wären vorhanden.
Michael K. Kärchner▶ Mein Leserbrief im Bergsträßer Anzeiger vom 31. Dezember 2025
Bensheim
Quellen & weiterführende Materialien
Grundlage der Analyse: gesetzliche Materialien, amtliche Statistiken, wissenschaftliche Studien und journalistische Berichte.
Land Hessen – Leerstandsgesetz beschlossen
Offizielle Pressemitteilung mit Zielsetzung, rechtlichem Rahmen und Begründung.
hessenschau.de – Spekulativer Wohnungsleerstand
Einordnung der Landtagsdebatte und der Regelungen zum hessischen Leerstandsgesetz.
Zensus 2022 – Wohnungsleerstand
Statistische Ämter des Bundes und der Länder – Ergebnisse zur Leerstandsquote 2022.
Umweltbundesamt – Flächeninanspruchnahme
Daten zum täglichen Flächenverbrauch in Deutschland und zum 30-Hektar-Ziel.
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
Studien zu Innenentwicklungspotenzialen und nachhaltiger Stadtplanung.
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR)
Forschung zu Flächensparen, Siedlungsentwicklung und Ressourceneffizienz.
Bergsträßer Anzeiger – Debatte in Bensheim
Bericht über die Stadtverordneten-Debatte zum hessischen Leerstandsgesetz.
SWR Wissen – „Das Ende der Neubaugebiete?“
Dokumentation zu Innenentwicklung und nachhaltigem Wohnungsbau ohne Flächenversiegelung.
Stand der Auswertung: Dezember 2025 / Januar 2026
1. Was ist die zentrale Aussage des Artikels?
2. Geht es darum, Eigentümer zu bestrafen oder zu enteignen?
3. Warum wird Neubau im Außenbereich kritisch gesehen?
4. Gibt es überhaupt genug Potenzial im Bestand?
5. Wie kann man Baulücken und Unternutzung sichtbar machen?
6. Warum ist Innenentwicklung für Kommunen so schwierig?
7. Warum werden Städte wie München, Freiburg oder Wien genannt?
8. Warum die Debatte, wenn Bensheim kein „angespannter Wohnungsmarkt“ ist?
9. Was fordert der Artikel konkret?
10. Ist das realistisch – oder nur Theorie?
Wie hat Dir der Artikel gefallen?
Zuletzt aktualisiert am 5. Januar 2026