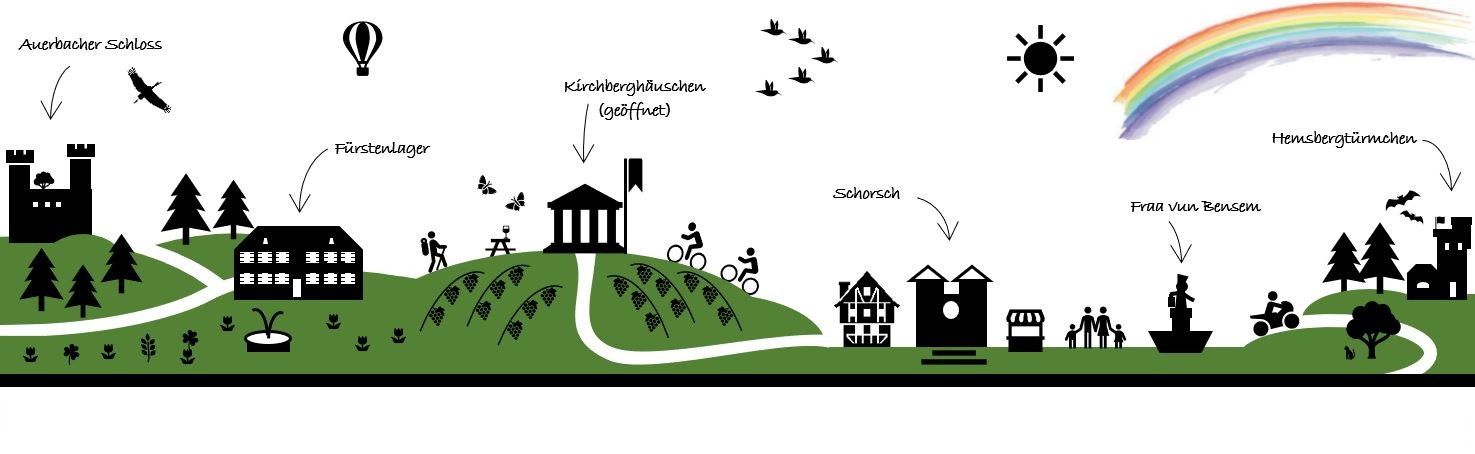Dieser Blog läuft mit Neugier, Kaffee und einer guten Portion Idealismus.
Ich schreibe, recherchiere, gestalte und pflege das alles in meiner Freizeit –
damit regionale Themen, Engagement und gute Geschichten sichtbar bleiben.
Wenn dir das gefällt, freue ich mich über eine kleine Unterstützung.
Jeder Beitrag hilft, dass ich diesen Blog mit der nötigen Zeit und Sorgfalt
weiterführen kann.
Danke dir!
Bisher 2042 mal gelesen, davon heute 1 mal
Lesedauer | 20 Minuten
Viele Vereine wünschen sich mehr junge Menschen – für frischen Wind, neue Ideen und eine zukunftsfähige Gemeinschaft. Doch was auf dem Papier einfach klingt, ist in der Praxis oft schwer umzusetzen. Warum bleiben die Jugendlichen weg? Wie kann man sie erreichen? Und was braucht es, damit sie nicht nur mitmachen, sondern bleiben?
Dieser Artikel liefert Antworten. Für Sportvereine genauso wie für Umweltgruppen, Musikensembles, Technikinitiativen oder soziale Projekte. Es geht nicht um Patentrezepte, sondern um Prinzipien: Wie kann ein Verein heute so wirken, dass er junge Menschen anspricht, begeistert – und zu Mitgestaltenden macht? Von der ersten Begegnung über gelungene Beteiligung bis hin zur langfristigen Bindung: Hier findest du Impulse, Ideen und konkrete Ansätze, wie aus einem Wunsch Wirklichkeit wird. Klar, ehrlich – und voller Möglichkeiten.
Mein Anlass, diesen Artikel zu verfassen ist recht simple. Das Thema wird in meinem nahen Umfeld gerade wieder aktuell diskutiert. Und ich merkte, dass es im Grunde die gleichen Diskussionen sind, die ich bereits seit über 20 Jahren führe und sie sich kaum unterscheiden. Anlass genug, einige Gedanken aufzuschreiben zu Dingen, die immer wieder auftauchen und auch vereinsübergreifend über Dekaden aktuell sind und vermutlich auch aktuell bleiben werden. Auch gibt es kaum ein anderes Themenfeld in Vereinen, wo nach wie vor eine ganze Menge falsch läuft. Also freue ich mich über alle Leser:innen und möchte euch auch gerne zu Rückmeldungen auffordern, hier, in den Kommentaren oder persönlich. Ich freue mich darauf!
Einleitung: Warum junge Menschen für Vereine so wichtig sind
Junge Menschen sind die Zukunft unserer Gesellschaft – und damit auch die Zukunft jedes Vereins. Ganz gleich, ob es um Sport, Umwelt, Musik, Technik oder Soziales geht: Ohne Nachwuchs fehlt nicht nur das personelle Fundament, sondern auch frische Energie, neue Ideen und der Mut, Dinge anders zu denken. Dennoch stehen viele Vereine vor der Herausforderung, Jugendliche und junge Erwachsene überhaupt zu erreichen – geschweige denn langfristig für die Vereinsarbeit zu begeistern. Seit ich mich ehrenamtlich engagiere, also spätestens seit 1996 sehe ich mich ständig und auch vereinsübergreifend mit diesem Thema konfrontiert.
Dafür gibt es viele Gründe: Der demografische Wandel sorgt dafür, dass es schlicht weniger junge Menschen gibt. Gleichzeitig hat sich die Lebensrealität dieser Generation stark verändert. Schule, Ausbildung, Studium, Nebenjobs, Social Media und ein hoher Anspruch an Freizeitgestaltung lassen wenig Raum für langfristige Bindungen – besonders dann, wenn diese auf verstaubten Strukturen und starren Hierarchien beruhen. Dabei brauchen gerade junge Menschen Orte, an denen sie sich ausprobieren, mitgestalten und wachsen können. Orte, an denen sie nicht nur „dabei sein“ dürfen, sondern wirklich zählen. Genau das kann ein Verein bieten – wenn er bereit ist, sich zu öffnen und die Lebenswelt der jungen Generation ernst zu nehmen.
Dieser Artikel zeigt, wie das gelingen kann. Er liefert Ideen, Beispiele und konkrete Werkzeuge, um junge Menschen nicht nur als Zielgruppe zu sehen, sondern als Mitgestalter:innen auf Augenhöhe zu gewinnen. Ob kleiner Dorfverein oder großes Netzwerk – die Prinzipien, die dabei helfen, gelten überall.
Ich schreibe diesen Artikel nicht aus der Perspektive eines Theoretikers, sondern als jemand, der seit knapp drei Jahrzehnten ehrenamtlich unterwegs ist – in Jugendgruppen, Vorständen, Gremien, Ausschüssen, als Vorsitzender, Mitdenker, Zuhörer, Motivator. Ich habe erlebt, wie Vereine aufblühen, wenn sie jungen Menschen wirklich Raum geben – und wie sie stagnieren, wenn sie es nicht tun. Viele der Gedanken in diesem Text sind das Ergebnis von Gesprächen, Erfolgen, Irrwegen, kleinen Glücksmomenten und der Überzeugung, dass Engagement nie selbstverständlich ist – aber immer möglich, wenn man es ernst meint.
Zielgruppe verstehen: Wer sind „die jungen Leute“ eigentlich?
Bevor wir darüber sprechen, wie man junge Menschen für den Verein gewinnt, sollten wir klären, wer damit überhaupt gemeint ist. „Die Jugend“ ist keine homogene Masse. Zwischen einer 13-jährigen Schülerin und einem 25-jährigen Berufseinsteiger liegen Welten – nicht nur biologisch, sondern auch gesellschaftlich, kulturell und emotional.
Altersgruppen unterscheiden
Um die Bedürfnisse und Interessen besser greifen zu können, lohnt es sich, die Zielgruppe grob zu unterteilen:
- Unter 12 Jahre: Noch stark im Kindesalter, oft in der Grundschule oder frühen weiterführenden Schule. Eltern oder Erziehungsberechtigte treffen fast alle Entscheidungen. Freizeitgestaltung findet meist im familiären Rahmen oder in betreuten Gruppen (z. B. Sport, Musik, Pfadfinder, Umweltgruppen) statt. Wichtig sind Spaß, spielerisches Lernen, feste Bezugspersonen und eine kindgerechte Ansprache. Erste Erfahrungen mit Gemeinschaft und Engagement entstehen häufig durch Vorbilder und niedrigschwellige Mitmachaktionen.
- 12–17 Jahre: Meist noch in Schule und Ausbildung. Eltern spielen eine große Rolle, ebenso Peergroups. Freizeit ist stark durch Schule, Hobbys, Social Media und Freundschaften geprägt. Diese Altersgruppe braucht vor allem Spaß, Orientierung und Zugehörigkeit.
- 18–25 Jahre: Übergang in Studium, Beruf oder Ausbildung. Erste Unabhängigkeit, viele Fragen an die Zukunft. Zeit ist ein knappes Gut, Werteorientierung wächst. Diese Gruppe sucht oft Sinn, Gemeinschaft und Möglichkeiten, sich zu entfalten.
- 26–30 Jahre: Häufig schon im Berufsleben. Manche mit Familiengründung beschäftigt, andere auf der Suche nach stabilen Netzwerken. Sie wollen Verantwortung übernehmen – aber nicht überfordert werden.
Diese Aufteilung ist natürlich nur ein grober Rahmen. Doch sie hilft, nicht in Allgemeinplätzen zu denken, sondern zielgruppengerecht anzusprechen. Viele Jugendliche und junge Erwachsene wachsen in einer Welt auf, die gleichzeitig offener, vernetzter, aber auch fordernder ist als je zuvor. Die ständige Vergleichbarkeit durch soziale Medien, ein hoher Leistungsdruck und globale Krisen prägen das Lebensgefühl. Gleichzeitig sehnen sich viele nach echten Erlebnissen, ehrlichen Kontakten und konkretem Engagement. Sie wollen gehört werden, etwas bewirken – und sich dabei nicht verbiegen müssen. Vereine können dafür genau der richtige Ort sein – wenn sie verstehen, wie junge Menschen ticken.
Was sie suchen – und was sie abschreckt
Attraktive Faktoren:
- Gemeinschaft auf Augenhöhe
- Spaß und Sinn statt Pflicht und Protokoll
- Möglichkeiten zur Mitgestaltung
- Moderne Kommunikation
- Flexible Beteiligungsformen
- Relevante Themen (z. B. Umwelt, Diversität, Digitalisierung)
Abschreckende Faktoren:
- Autoritäre Strukturen („Das haben wir schon immer so gemacht“)
- Lange Vereinsabende mit Tagesordnungspunkten, die niemand versteht
- Keine Willkommenskultur für „Neulinge“
- Starre Mitgliedschaftsmodelle
- Fehlende Sichtbarkeit nach außen
Der Verein als attraktiver Ort
Stell dir vor, ein junger Mensch stolpert über euren Verein. Entweder auf Social Media, bei einem Fest, durch Freund:innen oder in der Schule. Was sieht er? Was fühlt sie? Ist das ein Ort, der nach „Ich will dazugehören“ aussieht – oder eher nach „nur was für alte Hasen“?
Viele Vereine sind im Kern großartige Gemeinschaften. Doch sie wirken nach außen oft wie geschlossene Gesellschaften, bei denen man „erst mal jahrelang dabei sein muss“, bevor man mitreden darf. Damit ein Verein für junge Menschen attraktiv wird, braucht es mehr als ein Jugendangebot – es braucht eine Kultur der Offenheit, Mitgestaltung und Inspiration.
Ein Verein kann vieles sein: ein Ort der Begegnung, des Engagements, der Freude, der Entwicklung – oder eben auch ein Ort der Langeweile, der Barrieren und verpassten Chancen. Die entscheidende Frage lautet: Wirkt unser Verein wie ein einladender Raum, in dem junge Menschen sich wohlfühlen und mitgestalten wollen?
Gerade bei der Nachwuchsgewinnung zeigt sich, dass es nicht reicht, „einfach nur ein Jugendangebot“ zu schaffen. Es geht nicht darum, ein paar Veranstaltungen auf die Beine zu stellen und darauf zu hoffen, dass junge Menschen plötzlich in Scharen auftauchen. Vielmehr muss der Verein selbst als Ort wahrgenommen werden, der zugänglich, lebendig und relevant ist. Ein Ort, an dem man nicht nur „mitmachen darf“, sondern wirklich gewollt ist.
Der Verein als Bühne für Selbstwirksamkeit
Viele junge Menschen suchen heute nach Möglichkeiten, sich auszuprobieren – nicht nur in der Schule oder im Job, sondern in einem Umfeld, das ihre Fähigkeiten ernst nimmt. Vereine haben hier ein enormes Potenzial, das oft unterschätzt wird. Sie können Orte sein, an denen junge Menschen das erste Mal Verantwortung übernehmen, eigene Ideen umsetzen oder merken, dass ihre Meinung zählt. Doch das gelingt nur, wenn ihnen diese Räume auch wirklich geöffnet werden. Wer als Jugendlicher das Gefühl bekommt, dass seine Vorschläge ohnehin nicht ernst genommen werden oder er sich erst „hocharbeiten“ muss, wird sich kaum langfristig einbringen. Selbstverwirklichung braucht nicht nur Mitgestaltung, sondern vor allem Vertrauen in die Fähigkeiten junger Menschen.
Ein weiterer zentraler Aspekt: das Gefühl von Zugehörigkeit. In einer Zeit, in der viele Jugendliche sich zwischen digitalen Welten, Leistungsdruck und gesellschaftlicher Unsicherheit verlieren, ist echte Gemeinschaft ein Geschenk. Ein Verein kann genau diesen Halt bieten – vorausgesetzt, er lebt Gemeinschaft nicht nur als Schlagwort, sondern im Alltag. Neue Gesichter müssen aktiv integriert werden. Wer das erste Mal erscheint, sollte nicht allein in der Ecke sitzen, während die „alten Hasen“ unter sich bleiben. Ein kurzer Gruß reicht nicht. Es geht um eine gelebte Kultur des Willkommenseins. Junge Menschen merken schnell, ob sie wirklich dazugehören dürfen – oder ob sie nur geduldet werden.
Werte, die anziehend wirken
Nicht zu unterschätzen ist auch die Frage nach dem Wofür. Vereine, die klare Werte vertreten und diese sichtbar machen, wirken für junge Menschen besonders attraktiv. Dabei geht es nicht darum, politisch zu agitieren, sondern eine Haltung zu zeigen: gegen Diskriminierung, für Nachhaltigkeit, für Gerechtigkeit, für Beteiligung. In einer Welt voller Orientierungslosigkeit suchen viele Jugendliche nach einem Gegenpol – nach einem Ort, an dem sie sich mit Überzeugung engagieren können. Wenn der Verein sich hier klar positioniert – sei es auf der Website, in Veranstaltungen oder einfach im Umgang miteinander – entsteht eine starke Anziehungskraft. Glaubwürdigkeit ist dabei das A und O. Lippenbekenntnisse reichen nicht. Wer Vielfalt propagiert, muss sie leben. Wer Partizipation fordert, muss sie zulassen.
Natürlich spielen auch äußere Faktoren eine Rolle. Junge Menschen sind in einer digitalen Welt aufgewachsen. Wenn die Kommunikation im Verein ausschließlich über Aushänge und E-Mails läuft, wirkt das nicht nur altmodisch, sondern unpraktisch. Hier geht es weniger darum, jedem Trend hinterherzulaufen, sondern darum, niedrigschwellige und zeitgemäße Zugänge zu schaffen. Kommunikation auf Augenhöhe, eine lockere, freundliche Sprache und ein Verständnis für die Lebensrealität der Zielgruppe machen bereits einen großen Unterschied. Dabei gilt: Man muss nicht alles neu erfinden, aber man muss offen dafür sein, Dinge neu zu denken. Der Verein muss sich nicht verbiegen, aber er muss sich bewegen – und bereit sein, sich in den Spiegel zu schauen.
Innenschau: Was muss sich im Verein verändern?
Wenn junge Menschen einen Verein meiden, liegt das nicht immer daran, dass sie „keine Lust mehr auf Engagement“ haben. Viel häufiger liegt es daran, dass sie sich nicht gesehen, nicht angesprochen oder nicht ernst genommen fühlen. Und das hat oft mit der inneren Kultur eines Vereins zu tun – also mit dem, wie dort miteinander umgegangen, gedacht und organisiert wird. Viele Vereine wünschen sich mehr junge Mitglieder, ohne sich selbst zu hinterfragen. Dabei ist genau das der entscheidende Schritt. Denn Nachwuchsgewinnung ist keine Frage des Marketings, sondern des Mindsets. Wer junge Menschen einladen will, muss bereit sein, ihnen Platz zu machen. Nicht nur auf dem Flyer – sondern in der Struktur, im Denken, im Alltag.
In der Theorie betonen viele Vereine, wie offen sie für neue Mitglieder seien. Doch in der Praxis zeigt sich schnell: Eingespielte Abläufe, informelle Hierarchien und ein hohes Maß an Vereinsmeierei können neue Gesichter schnell abschrecken. Besonders dann, wenn sie das Gefühl bekommen, sich erst durch ein unsichtbares Regelwerk kämpfen zu müssen, bevor sie mitgestalten dürfen. Junge Menschen spüren sehr genau, ob ihre Ideen willkommen sind – oder ob sie auf taube Ohren stoßen. Und sie entscheiden schneller als ältere Generationen, ob sich Engagement lohnt. Es reicht also nicht, zu sagen: „Du darfst mitmachen.“ Es braucht eine Kultur, die wirklich Zuhören, Beteiligung und Mitverantwortung lebt.
Machtstrukturen überprüfen
Viele Vereine funktionieren seit Jahrzehnten über sehr ähnliche Strukturen: ein enger Vorstand, langjährige Funktionsträger:innen, wenig Fluktuation. Das ist stabil, aber oft auch starr. Wer neu dazukommt – insbesondere als junger Mensch – hat es schwer, sich einzubringen, wenn er oder sie nicht Teil des informellen Kerns ist. Deshalb braucht es bewusst geschaffene Räume: Jugendbeisitz im Vorstand, Arbeitsgruppen mit flacher Hierarchie, Feedback-Runden, bei denen auch Kritisches gesagt werden darf. Nicht, um das „alte System“ abzuschaffen, sondern um es zukunftsfähig zu erweitern. In einem sehr frühen Artikel habe ich beschrieben, wie man Jugendstrukturen organisiert entwickeln kann, so wie ich es beispielsweise vor vielen Jahren in der Volleyballabteilung der TSV Auerbach gemacht habe.
Viele Vereine scheuen Veränderungen, weil sie Angst haben, etwas falsch zu machen. Dabei ist genau das der Schlüssel: Mut zum Experiment, zur neuen Idee – auch wenn mal was schiefläuft. Junge Menschen sind bereit, sich einzubringen – aber nicht, wenn sie das Gefühl haben, für jeden Fehler verurteilt zu werden oder sich alles „erst verdienen“ zu müssen. Eine gute Fehlerkultur bedeutet: Wir probieren Neues aus. Wir besprechen, was funktioniert hat – und was nicht. Und wir lernen daraus. Das ist nicht nur jugendfreundlich, sondern ein Gewinn für den ganzen Verein. Gerade dieser „Vertrauensaufbau“ hat damals viele Monate gekostet. „Was ist, wenn die Jugendlichen einen Fehler machen?“ bis hin zur totalen Ablehnung, jungen Menschen Verantwortung, vor allem auch finanzielle Verantwortung zu übertragen.
Verwaltung und Bürokratie vereinfachen
Ein weiterer Stolperstein liegt oft im Organisatorischen: Mitgliedsanträge, lange Formulare, unnötig komplexe Prozesse. Für jemanden, der zum ersten Mal Kontakt mit dem Verein hat, kann das eine echte Hürde sein. Digitalisierung ist hier kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit: Online-Mitgliedschaft, einfache Anmeldeformulare, digitale Kommunikation – das alles spart nicht nur Arbeit, sondern senkt auch die Einstiegsschwelle. Wenn ein junger Mensch schon beim ersten Kontakt mit dem Gefühl konfrontiert wird, sich durch einen Verwaltungsakt kämpfen zu müssen, wird er oder sie sich vermutlich schnell wieder abwenden.
Innenschau bedeutet nicht Selbstzerfleischung. Es geht nicht darum, alles Bestehende infrage zu stellen – sondern darum, den eigenen Verein ehrlich zu betrachten: Was läuft gut? Was ist vielleicht aus der Zeit gefallen? Und wo könnten wir Raum schaffen für neue Ideen, neue Menschen, neue Impulse? Veränderung braucht Mut. Aber wer diesen Mut aufbringt, wird oft mit genau dem belohnt, was so viele Vereine sich wünschen: frischer Wind, neue Gesichter – und die Gewissheit, dass der eigene Verein auch morgen noch eine lebendige Rolle in der Gesellschaft spielt.
Kommunikation & Ansprache: So erreicht man junge Menschen
Der beste Verein bringt nichts, wenn niemand davon erfährt. Und genau hier liegt eine der größten Herausforderungen: Viele Vereine kommunizieren so, wie sie es immer getan haben – über Schaukästen, gedruckte Mitteilungen, vielleicht eine Vereinszeitschrift oder eine wenig gepflegte Homepage. Für viele junge Menschen sind das allerdings unsichtbare Kanäle. Wer sie erreichen will, muss sich dorthin begeben, wo sie sich aufhalten – und in einer Sprache sprechen, die sie verstehen.
Das heißt nicht, dass man zwanghaft auf TikTok tanzen muss. Aber es bedeutet, die Kommunikationswege zu modernisieren – ehrlich, nahbar und zeitgemäß.
Wo erreiche ich junge Menschen? – Die richtigen Kanäle
- Instagram: Visuelles Netzwerk, ideal für Fotos von Aktionen, Veranstaltungen, Menschen im Verein. Storys und Reels funktionieren besonders gut.
- TikTok: Für die Mutigen – kurze, kreative Clips mit Augenzwinkern. Gut für Reichweite, aber nur sinnvoll, wenn es zur Vereinskultur passt.
- WhatsApp & Signal: Für interne Gruppenkommunikation – schnell, persönlich, niedrigschwellig. Ideal für Jugendgruppen oder Projektteams.
- Discord: Besonders bei technikaffinen oder kreativen Jugendlichen beliebt – z. B. in Gaming-, Musik- oder Digitalvereinen.
- YouTube / Twitch: Wenn regelmäßig Inhalte entstehen – z. B. Tutorials, Interviews oder Livestreams.
- Schulnetzwerke & lokale Kooperationen: Aushänge, Projektwochen, AGs oder Mitmachaktionen an Schulen, Jugendzentren oder Unis sind oft wirkungsvoller als jeder Flyer.
Wichtig: Weniger ist mehr. Lieber ein oder zwei Kanäle richtig gut nutzen als überall halbherzig präsent sein. Entscheidend ist, wer die Kanäle betreut – und ob die Inhalte aktuell, authentisch und ansprechend sind.
Wie spreche ich junge Menschen an? – Die richtige Sprache
Die Sprache, in der ein Verein kommuniziert, entscheidet mit darüber, ob sich junge Menschen angesprochen fühlen – oder nicht.
- Locker, aber nicht anbiedernd. Es braucht keine Jugendsprache oder peinliche Emojis, sondern eine klare, freundliche Ansprache ohne Amtsdeutsch.
- Direkt und persönlich. Statt „Wir würden uns freuen, wenn…“ lieber: „Komm vorbei und mach mit!“
- Ehrlich und transparent. Erklärt, was man wirklich macht – und warum das sinnvoll oder cool ist. Nichts verschleiern, nichts aufhübschen.
- Selbstironisch statt belehrend. Wer sich selbst nicht zu ernst nimmt, wirkt nahbar. Wer sich belehrend über die „Generation Smartphone“ äußert, eher abschreckend.
Ein Beispiel:
Nicht: „Am Samstag findet erneut der alljährliche Arbeitseinsatz zur Vereinsplatzpflege statt. Wir bitten um rege Teilnahme.“
Besser: „Samstag? Gemeinsam anpacken, dreckig werden, Pizza danach. Komm vorbei – wir freuen uns auf dich!“
Was interessiert junge Menschen überhaupt an einem Verein?
In jeder Ansprache sollte klar werden: Was habe ich davon, mitzumachen? Denn Engagement ist heute keine Selbstverständlichkeit – es konkurriert mit vielen anderen Möglichkeiten. Zeigt, was man gewinnen kann:
- Neue Leute kennenlernen
- Coole Projekte umsetzen
- Spaß, Anerkennung, Gemeinschaft
- Dinge lernen, die im Leben weiterhelfen
- Sich engagieren für etwas, das zählt
Kommunikation ist dabei keine Einbahnstraße. Wer junge Menschen wirklich einbinden will, sollte auch zuhören: Was interessiert sie? Was fehlt? Was würde sie überzeugen? Es muss nicht immer der Verein selbst sein, der junge Menschen anspricht. Oft sind es einzelne Personen, die Türen öffnen:
- Junge Engagierte aus dem Verein, die andere mitziehen
- Lehrer:innen oder Sozialarbeiter:innen, die den Verein empfehlen
- Lokale Social-Media-Personas oder Influencer:innen
- Ehemalige Mitglieder, die heute in der Stadtverwaltung, der Presse oder einem Unternehmen sitzen
Einstieg erleichtern: Die ersten Schritte attraktiv gestalten
Der Moment, in dem ein junger Mensch zum ersten Mal Kontakt mit einem Verein aufnimmt, ist entscheidend. Ob auf einer Veranstaltung, durch eine Social-Media-Aktion oder weil ein Freund ihn oder sie mitbringt – dieser erste Eindruck prägt das gesamte Bild vom Verein. Und er entscheidet darüber, ob aus einem kurzen Besuch echtes Engagement werden kann – oder eben nicht.
Gerade in der Anfangsphase ist es wichtig, die Schwelle zum Mitmachen möglichst niedrig zu halten. Viele Vereine verlangen viel zu früh formale Entscheidungen – eine Mitgliedschaft, regelmäßige Treffen, aktive Mitarbeit. Doch wer noch nicht weiß, wie der Verein tickt, möchte sich erst einmal orientieren dürfen, ohne sich gleich festzulegen. Der Einstieg sollte also nicht über ein Formular, sondern über Begegnung funktionieren. Schnupperangebote, offene Treffen oder Projekttage sind ideal, um erste Erfahrungen zu sammeln. Hier zählt vor allem die Atmosphäre: Wird man freundlich begrüßt? Nimmt sich jemand Zeit? Wird erklärt, worum es geht?
Der erste Kontakt sollte sich nicht anfühlen wie ein Vorstellungsgespräch, sondern wie eine Einladung. Ein einfaches „Schön, dass du da bist – hast du Lust, gleich mitzumachen?“ wirkt oft mehr als jedes ausgeklügelte Konzept. Es geht darum, Menschen das Gefühl zu geben, willkommen und gesehen zu werden. Wer neu ist, bringt Unsicherheiten mit – und möchte nicht gleich in ein System gedrückt werden, das sich nur um sich selbst dreht.
Dabei hilft es enorm, wenn es im Verein Menschen gibt, die den Einstieg aktiv begleiten. Das können jüngere Mitglieder sein, die sich um Neue kümmern, ihnen den Verein zeigen und sie mit anderen bekannt machen. Auch kleine Gesten helfen: eine kurze Vorstellungsrunde, ein lockeres Willkommensgespräch, vielleicht ein gemeinsames Essen oder ein humorvoller Einstieg. Es muss kein aufwändiges Patensystem sein – entscheidend ist, dass sich niemand verloren fühlt.
Ein häufiges Missverständnis ist der Wunsch nach sofortiger Verbindlichkeit. Viele Vereine sehnen sich nach jungen Leuten, die sich engagieren – und drücken ihnen dann schnell Aufgaben in die Hand oder binden sie an langfristige Termine. Doch genau das wirkt abschreckend. Denn junge Menschen möchten erst erleben, was ein Engagement ihnen bringt, bevor sie selbst investieren. Verbindlichkeit wächst aus Begeisterung, nicht aus Erwartung. Deshalb gilt: Erst zeigen, dass der Verein Spaß macht und etwas bedeutet – dann kann auch Verantwortung wachsen.
Der Einstieg in einen Verein darf sich nicht wie eine Mutprobe anfühlen. Kein Prüfungsszenario, kein Abarbeiten von To-dos. Sondern ein freundlicher, neugieriger, offener Raum. Wer diesen Einstieg bewusst gestaltet, der schafft die besten Voraussetzungen dafür, dass junge Menschen sich nicht nur für einen Moment, sondern für eine längere Zeit binden möchten.
Beteiligung ermöglichen: Verantwortung übertragen
Viele Vereine wünschen sich junge Menschen, die nicht nur mitmachen, sondern sich einbringen, Verantwortung übernehmen, Dinge vorantreiben. Doch das geschieht nicht einfach, weil man jemanden fragt: „Willst du nicht auch mal was machen?“ Echte Beteiligung entsteht dort, wo Engagement nicht nur erlaubt, sondern wirklich gewollt und ermöglicht wird. Und genau das ist der Punkt, an dem viele Vereine unbewusst scheitern – sie schaffen Strukturen, in denen junge Menschen zwar theoretisch willkommen sind, sich aber praktisch kaum entfalten können.
Es ist ein Unterschied, ob jemand bei einer Aktion mithilft – oder ob er oder sie spürt: „Ich darf hier wirklich etwas gestalten.“ Gerade junge Menschen wollen nicht nur Aufgaben übernehmen, sie möchten wirken. Sie wollen spüren, dass ihre Ideen gehört und ihre Entscheidungen relevant sind. Das heißt nicht, dass sie alles besser wissen oder von Anfang an perfekt funktionieren. Aber sie bringen oft frische Perspektiven, andere Prioritäten und den Mut, neue Wege zu gehen. Wer das als Verein nutzen will, muss bereit sein, auch ein Stück Kontrolle abzugeben.
Das beginnt bei kleinen Dingen: Wollen wir die Aktion dieses Jahr wieder genauso machen wie immer – oder lassen wir die Jugendgruppe ihre eigene Version entwickeln? Können wir Verantwortung für das Social-Media-Team wirklich an die 17-Jährige abgeben – auch wenn sie vielleicht Emojis verwendet, die wir nicht verstehen? Trauen wir dem 20-Jährigen zu, ein Projekt eigenständig zu leiten – auch wenn er noch nie einen Förderantrag gestellt hat?
Natürlich bedeutet das manchmal, dass Dinge schiefgehen. Dass etwas nicht rund läuft. Dass ein Konzept nicht ganz aufgeht. Aber genau das gehört dazu – und ist Teil einer Lernkultur. Junge Menschen brauchen Räume, in denen sie Verantwortung ausprobieren dürfen, ohne für jeden Fehler kritisiert zu werden. Wo sie wachsen können – fachlich, persönlich und im Team. Dafür braucht es Mut auf beiden Seiten: Mut der Jugendlichen, sich einzubringen – und Mut des Vereins, sie wirklich zu beteiligen.
Ein guter Weg dahin ist, konkrete Mitmachformate zu schaffen, die auf Beteiligung ausgelegt sind: ein Jugendbeirat, ein Projektteam für eine besondere Aktion, ein eigenes Budget für die Jugendarbeit, das sie selbst verwalten dürfen. Auch ein Beisitz im Vorstand für die Jugend kann ein starkes Signal sein: „Eure Stimme zählt – nicht irgendwann, sondern jetzt.“
Ebenso wichtig ist, dass junge Engagierte nicht in die zweite Reihe gestellt werden. Es reicht nicht, ihnen Aufgaben zu geben, wenn sie bei Entscheidungen nicht einbezogen werden. Beteiligung bedeutet eben nicht nur Mitarbeit, sondern Mitverantwortung und Mitsprache.
Und schließlich braucht es Vertrauen. Junge Menschen, die sich engagieren, spüren sehr genau, ob sie ernst genommen oder nur für Imagezwecke eingebunden werden. Wer sie wirklich beteiligt, zeigt ihnen: Du bist nicht nur willkommen – du bist wichtig.
Ein Verein, der Verantwortung teilt, gewinnt nicht nur an Zukunftsfähigkeit, sondern auch an Vielfalt, Lebendigkeit und Glaubwürdigkeit. Denn es ist diese echte Beteiligung, die aus Zuschauer:innen Mitmacher:innen macht – und aus Mitmacher:innen tragende Säulen für morgen.
Formate, die begeistern – Was junge Menschen wirklich anspricht
Mitglieder gewinnt man nicht mit Paragrafen – sondern mit Emotionen. Was junge Menschen für einen Verein begeistert, sind nicht nur gute Argumente, sondern echte Erlebnisse, inspirierende Projekte und das Gefühl, Teil von etwas Besonderem zu sein. Es geht nicht nur um Inhalte – sondern um Atmosphäre, um Teilhabe und um das gewisse Etwas, das Lust macht, wiederzukommen.
Viele Vereine stecken viel Energie in Sitzungen, Berichte und Traditionen – aber zu wenig in das Erlebnis selbst. Doch gerade für Jugendliche zählt das: Werde ich gebraucht? Habe ich Spaß? Kann ich etwas gestalten? Pflichttermine, Protokolle und endlose Abstimmungen sind selten der Grund, warum sich junge Menschen engagieren. Was sie dagegen begeistert, sind Formate mit Leben, Bedeutung und einem guten Gefühl danach. Es dürfen kleine Dinge sein – aber sie müssen echt sein.
- Ein Musikverein, der eine Jugendband gründet, die ihren ganz eigenen Sound entwickeln darf.
- Ein Sportverein, der ein Jugendturnier organisiert – mit selbstgestaltetem Rahmenprogramm.
- Ein Umweltverein, der Jugendlichen zutraut, ihre eigene Baumpflanzaktion durchzuziehen.
- Ein Kulturverein, der jungen Menschen die Bühne überlässt – für ihre Themen, ihre Formate.
Solche Projekte müssen nicht perfekt sein – aber sie müssen Raum bieten für Selbstwirksamkeit. Denn es ist dieses Gefühl – „Ich habe etwas bewirkt“ – das junge Menschen zurückkommen lässt. Der größte Fehler wäre, Jugendliche sich selbst zu überlassen – und sich dann zu wundern, wenn sie nach kurzer Zeit abspringen. Genauso falsch wäre es, ihnen alles vorzuschreiben und zu kontrollieren. Gute Formate bieten Freiheit mit Rückhalt: Man darf kreativ sein, Entscheidungen treffen, Fehler machen – aber weiß, dass jemand da ist, wenn man Hilfe braucht. Das stärkt nicht nur die Qualität der Projekte, sondern auch die Bindung zum Verein.
Gemeinschaft sichtbar machen
Viele junge Menschen engagieren sich nicht für das Thema allein – sondern für das Gefühl, gemeinsam etwas zu erleben. Deshalb sollten Vereinsformate auch genau das ermöglichen: Gemeinschaft spüren, Freundschaften schließen, Teil von etwas Größerem sein. Ein Wochenende in der Natur, eine gemeinsame Fahrt, ein Festival, ein Mitmachcamp – oft sind es genau diese Momente, die den Unterschied machen. Sie schaffen Erinnerungen – und aus Erinnerungen wächst Verbundenheit.
Was man selbst gemacht hat, darf auch gesehen werden. Junge Menschen möchten zeigen dürfen, worauf sie stolz sind. Ein Video vom eigenen Projekt, ein Zeitungsartikel, ein Insta-Post vom Team – das sind keine Nebensachen, sondern Teil der Erfahrung. Wer heute etwas aufbaut, will es teilen. Und das ist gut so. Vereine, die den Erfolg ihrer jungen Engagierten sichtbar machen – auf Social Media, auf der Website, bei Veranstaltungen –, stärken deren Motivation enorm. Gleichzeitig zeigen sie Außenstehenden: Hier passiert was. Hier kann man etwas bewegen.
Manchmal wirken Projekte wie große Berge. Aber es braucht nicht immer das Mega-Event. Oft reicht eine Idee, ein Raum, eine Gruppe, ein bisschen Mut. Ob Nachhaltigkeitsprojekt, Podcast, Skate-Workshop, Theaterstück, Mitmachblog, Coding-Camp oder Kickerturnier – entscheidend ist nicht die Größe, sondern die Haltung dahinter: Du darfst hier etwas machen. Du darfst hier etwas sein. Formate, die junge Menschen begeistern, sind nicht nur Programm – sie sind Haltung. Sie sagen: „Wir trauen dir etwas zu. Wir geben dir Raum. Wir feiern deine Ideen.“ Und genau das ist der Stoff, aus dem echte Bindung wächst – und eine neue Generation Vereinsleben entstehen kann.
Kooperationen & Netzwerke – Gemeinsam mehr erreichen
Kein Verein ist eine Insel. Wer heute junge Menschen erreichen will, sollte nicht nur in die eigene Satzung schauen – sondern auch nach rechts und links. Denn oft entsteht genau dort, wo man sich vernetzt, öffnet und gemeinsam denkt, der Raum, in dem neue Impulse entstehen. Gerade Jugendliche sind selten „vereinsfixiert“. Sie denken nicht in Vereinsgrenzen, sondern in Lebenswelten. Schule, Freizeit, Freundeskreis, Engagement, Social Media – all das vermischt sich. Und genau hier können Kooperationen ansetzen. Wer mit Partnern zusammenarbeitet, erreicht mehr – und wirkt relevanter.
Viele junge Menschen verbringen den Großteil ihrer Zeit in Schule oder Ausbildung. Wer dort präsent ist – nicht belehrend, sondern einladend – wird auch wahrgenommen. Schulkooperationen, AGs, Projektwochen, Praktikumsangebote oder gemeinsame Aktionen sind wertvolle Türöffner. Genauso können Jugendzentren, offene Treffs oder soziale Einrichtungen wichtige Partner sein. Oft gibt es dort engagierte Fachkräfte, die Kontakte herstellen und mithelfen können, erste Brücken zu bauen. Wichtig ist: nicht nur Flyer abgeben, sondern echten Kontakt herstellen – gemeinsam Ideen spinnen, Angebote entwickeln, Projekte starten.
Gerade in kleineren Städten oder ländlichen Regionen kämpfen viele Vereine um dieselben jungen Menschen. Anstatt sich gegenseitig Konkurrenz zu machen, wäre es oft klüger, Synergien zu suchen. Warum nicht mal ein gemeinsames Sommerfest? Oder ein Kooperationsprojekt zwischen Sportverein und Naturschutzgruppe? Oder ein gemeinsames Jugendteam aus drei kleinen Vereinen, die jeweils nicht genug Leute hätten? Kooperation heißt: Ressourcen teilen, Ideen bündeln, Reichweite vergrößern. Und sie zeigt Jugendlichen: Hier geht es nicht um Vereinsmeierei – sondern ums Miteinander.
Oft gibt es auf kommunaler Ebene Strukturen, die man nutzen kann – man muss sie nur kennen. Jugendparlamente, Stadtjugendringe, Bildungsbüros, Integrationsstellen oder Klimabeauftragte: All diese Institutionen haben ein Interesse daran, dass Jugendliche sich engagieren. Ein Verein, der dort auftaucht, wird gesehen – und bekommt Zugang zu Kontakten, Räumen, Fördermitteln und Sichtbarkeit. Auch die Mitarbeit an Jugendstrategie-Prozessen oder in Stadtentwicklungsgruppen kann sinnvoll sein: Wer dort mitredet, wird Teil des Netzwerks. Und Netzwerke sind der Nährboden für stabile Strukturen.
Anerkennung zeigen – ehrlich und sichtbar
Junge Menschen wollen nicht im Rampenlicht stehen – aber sie wollen gesehen werden. Wer sich engagiert, sollte spüren: Das wird wahrgenommen. Und geschätzt. Anerkennung ist mehr als ein „Danke“. Es ist:
- Die persönliche Rückmeldung im richtigen Moment.
- Die Nennung im Newsletter oder auf Social Media.
- Der Applaus bei der Mitgliederversammlung.
- Die Empfehlung für ein Stipendium oder eine Ausbildung.
- Die Einladung, an Entscheidungsprozessen mitzuwirken.
Anerkennung schafft Bindung. Sie sagt: „Du bist nicht nur dabei – du bist ein wichtiger Teil von uns.“
Beteiligung braucht Räume – und Stufen
Wer junge Menschen für den Verein gewinnen will, sollte nicht nur überlegen, ob Beteiligung möglich ist, sondern wo und wie. Dabei hilft es, Beteiligung systematisch zu betrachten: auf welchen Ebenen ist sie im Vereinsleben möglich – und in welchen Stufen kann sie stattfinden?
Die folgende Matrix unterscheidet drei klassische Ebenen, die in fast jedem Verein vorkommen – unabhängig davon, ob es sich um einen Sportverein, ein Musikensemble, eine Umweltgruppe oder eine soziale Initiative handelt:
- Praxis/Angebot: die regelmäßigen Aktivitäten, für die der Verein inhaltlich steht.
- Rahmen/Aktivitäten: alles rund um Ausflüge, Feste, Fahrten oder gemeinschaftliche Aktionen.
- Gremien/Organisation: die strukturgebende Seite – von Projektgruppen bis hin zur Vorstandsarbeit.
Auf jeder dieser Ebenen gibt es verschiedene Stufen der Beteiligung. Sie reichen vom einfachen Mitmachen bis zur vollen Verantwortung. Diese Stufen verstehen sich nicht als starre Reihenfolge, sondern als Entwicklungsmöglichkeiten. Manche steigen schnell ein und übernehmen zügig Verantwortung. Andere brauchen mehr Zeit – und das ist völlig in Ordnung. Entscheidend ist, dass der Verein Räume schafft, die diese Entwicklung ermöglichen:
- Mitmachen: Erste Schritte – unverbindlich, neugierig, ohne Druck.
- Mitbestimmen: Eigene Ideen äußern, gefragt werden, gehört werden.
- Mitgestalten: Angebote aktiv mitentwickeln – kreativ, konkret, erlebbar.
- Mitverantworten: Teilverantwortung übernehmen – im Team, mit Rückhalt.
- Selbst verantworten: Eigenständige Leitung von Projekten, Gruppen oder Formaten.
Diese Matrix hilft, junge Engagierte dort abzuholen, wo sie stehen – und ihnen die nächste Stufe zu ermöglichen. Sie lädt dazu ein, die eigene Vereinsstruktur zu reflektieren: Wo bieten wir jungen Menschen echte Beteiligung? Wo bleiben wir noch zu sehr bei symbolischer Einbindung? Und vor allem: Wie schaffen wir Wege, auf denen Engagement wachsen kann – von der ersten Idee bis zur echten Mitverantwortung?
| Beteiligungsstufe \ Ebene | Praxis/Angebot | Rahmen/Aktivitäten | Gremien/Organisation |
|---|---|---|---|
| Mitmachen | Teilnahme an regelmäßigen Angeboten (z. B. Training, Aktion, Probe) | Teilnahme an Festen, Ausflügen, Mitmachaktionen | Teilnahme an offenen Sitzungen oder Gruppentreffen |
| Mitbestimmen | Themenvorschläge einbringen, eigene Interessen äußern | Ideen für Aktionen äußern, bei Umfragen mitmachen | Meinungsäußerung, Anregungen, Feedback geben |
| Mitgestalten | Kleinere Elemente des Angebots mitentwickeln (z. B. Programmideen, Übungen) | Mitplanung von Events, Gestaltung von Programmpunkten | Beteiligung an Arbeitsgruppen oder Projekten |
| Mitverantworten | (Mit-)Leitung einer Gruppe, Planung von Terminen | Verantwortung für bestimmte Bereiche bei Aktionen (z. B. Technik, Deko) | Mitarbeit im Team mit klaren Aufgaben, z. B. Öffentlichkeitsarbeit |
| Selbst verantworten | Leitung einer Einheit, selbstständiges Planen und Durchführen | Organisation ganzer Veranstaltungen, Budgetverwaltung, Teamleitung | Übernahme offizieller Funktionen (z. B. Jugendbeirat, Projektleitung) |
Fazit: Jugend gewinnen ist kein Projekt – sondern eine Haltung
Viele Vereine wünschen sich junge Mitglieder. Sie suchen „Nachwuchs“, planen Aktionen, organisieren Schnupperangebote oder schalten Anzeigen. Und all das kann helfen – aber nur dann, wenn die Haltung dahinter stimmt. Denn junge Menschen sind kein Projekt. Kein „Thema“, das man einmal angeht und dann abhakt. Sie sind Teil der Gesellschaft. Teil der Zukunft. Und sie möchten als solche behandelt werden – nicht als Zielgruppe, sondern als Mitgestalter:innen.
Wer Jugend wirklich gewinnen will, muss aufhören, von „ihnen“ zu sprechen – und anfangen, mit ihnen zu arbeiten. Es geht nicht um Programme, sondern um Kultur. Nicht um Maßnahmen, sondern um Beziehungen. Nicht um Kontrolle, sondern um Vertrauen. Jugend gewinnen heißt: loslassen lernen. Loslassen von alten Denkmustern, von starren Hierarchien, von der Angst vor Veränderung. Denn Veränderung ist nichts, was dem Verein schadet – sie ist das, was ihn lebendig hält. Junge Menschen bringen neue Ideen mit, neue Sichtweisen, neue Wege. Wer das zulässt, gewinnt mehr als nur Mitglieder: Er gewinnt Zukunft.
Jugend gewinnen heißt: zuhören. Nicht überlegen, was man „für“ junge Menschen tun kann – sondern sie fragen, was sie bewegt. Was sie brauchen. Was sie einbringen möchten. Und dann den Mut haben, diese Antworten auch umzusetzen – selbst wenn sie unbequem sind. Jugend gewinnen heißt: auf Augenhöhe agieren. Es geht nicht darum, jungen Menschen etwas beizubringen – sondern gemeinsam zu lernen. Es geht nicht darum, sie zu „integrieren“ – sondern ihnen Raum zu geben, die Kultur des Vereins mitzugestalten. Wer ihnen das Gefühl gibt, wichtig zu sein, wird ihre Loyalität und ihr Engagement erleben.
Und: Jugend gewinnen heißt auch, sich selbst treu zu bleiben – nur eben offen. Man muss keinen TikTok-Kanal haben, um attraktiv zu sein. Aber man muss verstehen, warum junge Menschen dort sind. Man muss nicht jedes Trendwort kennen. Aber man sollte wissen, wie sich junge Lebenswelten heute anfühlen. Es geht nicht um Coolness – sondern um Echtheit. Um das ehrliche Angebot: Du darfst hier du selbst sein. Und etwas verändern.
Der Gewinn liegt nicht nur bei den Jugendlichen. Ein Verein, der sich für junge Menschen öffnet, wird sich selbst neu erleben: dynamischer, vielfältiger, kreativer. Und das wirkt weit über die Jugendgruppe hinaus. Es verändert Strukturen, belebt Traditionen und bringt frischen Wind in den gesamten Verein. Am Ende bleibt also nicht die Frage: Wie kriegen wir junge Leute in den Verein? Sondern: Sind wir bereit, uns so zu verändern, dass sie bleiben wollen? Wenn die Antwort „Ja“ lautet, dann braucht es kein großes Konzept. Sondern offene Türen. Und offene Herzen.
Wie hat Dir der Artikel gefallen?
Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2025