Dieser Blog läuft mit Neugier, Kaffee und einer guten Portion Idealismus.
Ich schreibe, recherchiere, gestalte und pflege das alles in meiner Freizeit –
damit regionale Themen, Engagement und gute Geschichten sichtbar bleiben.
Wenn dir das gefällt, freue ich mich über eine kleine Unterstützung.
Jeder Beitrag hilft, dass ich diesen Blog mit der nötigen Zeit und Sorgfalt
weiterführen kann.
Danke dir!
Bisher 1260 mal gelesen, davon heute 3 mal
Lesedauer | 6 Minuten
Bensheim steht vor schwierigen Zeiten. Wie viele Städte sieht sich auch unsere Stadt einer dramatischen finanziellen Schieflage gegenüber. Rückläufige Gewerbesteuereinnahmen und Nachzahlungen aus Vorjahren haben ein Loch in den Haushalt gerissen, das sich nicht einfach durch kleine Korrekturen schließen lässt. Was bedeutet das für das tägliche Leben in unserer Stadt – und besonders für die Vereine, die seit Jahrzehnten das soziale, kulturelle und sportliche Miteinander tragen?
Schon jetzt ist klar: Die finanziellen Einschnitte werden nicht nur auf dem Papier sichtbar sein. Wenn freiwillige Leistungen – zu denen auch die Unterstützung der Vereinsarbeit gehört – zur Disposition gestellt werden, drohen weitreichende Konsequenzen für das Herz unserer Stadtgesellschaft.
Vereine sind das soziale Rückgrat der Stadt
Vereine sind weit mehr als nur Freizeitangebote oder organisatorische Strukturen. Sie sind Orte der Begegnung, des Lernens, des Mitgefühls. In ihnen kommen Menschen aller Altersgruppen und Hintergründe zusammen. Hier wird Gemeinschaft erlebbar – unabhängig von Herkunft, Einkommen oder Bildungsstand.
Gerade in einer Zeit, in der gesellschaftlicher Zusammenhalt nicht mehr selbstverständlich ist, leisten Vereine unschätzbare Arbeit: Sie fördern den Nachwuchs, bieten Jugendlichen Perspektiven, begleiten ältere Menschen im Alltag und schaffen Kulturangebote, die für viele Menschen überhaupt erst Zugang zu Theater, Musik oder Sport ermöglichen. Sie sind lebendige Brücken zwischen den Generationen, stärken den gesellschaftlichen Frieden und fangen auf, wo staatliche Angebote enden. Diese Aufgaben geschehen meist im Stillen. Sie kosten Kraft, Zeit – und auch Geld. Ehrenamtliche Arbeit ist unbezahlbar, doch sie ist nicht kostenfrei.
Auch wenn Vereinsarbeit auf Idealismus und Engagement beruht, bleibt sie auf eine gewisse Grundunterstützung angewiesen. Ob Hallenmiete, Versicherung, Instandhaltung von Geräten, Ausbildung von Übungsleitern oder Anschaffung von Arbeitsmaterialien – hinter jedem Sporttraining, jedem Konzert, jedem Umweltprojekt stehen unzählige kleine Ausgaben, die sich summieren. Gerade kleinere Vereine, die ausschließlich auf Ehrenamt basieren und keine großen Rücklagen haben, können solche Belastungen ohne Unterstützung nicht stemmen.
Ein Wegfall der Zuschüsse würde hier nicht einfach die Qualität der Angebote mindern – er könnte dazu führen, dass ganze Strukturen wegbrechen. Wenn eine Stadt den Gürtel enger schnallen muss, ist das verständlich. Aber wenn sie an den Fundamenten spart, die das soziale Leben tragen, spart sie am falschen Ende.
Vereinsarbeit ist längst finanzieller und organisatorischer Kraftakt
Wer glaubt, dass Vereinsförderung bedeutet, Vereinen einfach Geld zu schenken, verkennt die Realität. Schon heute stemmen Vereine enorme Eigenleistungen, um ihre Angebote überhaupt aufrechterhalten zu können. Viele Vereine organisieren Crowdfunding-Kampagnen, starten Spendenaktionen oder veranstalten Benefizveranstaltungen, um zusätzliche Mittel zu gewinnen. Immer häufiger werden Fördervereine gegründet, die gezielt Gelder akquirieren – ein Schritt, der erneut ehrenamtliches Engagement voraussetzt: Menschen, die bereit sind, ihre Zeit nicht für die Vereinsarbeit selbst, sondern für Organisation, Buchhaltung, Antragsstellung und Fundraising einzusetzen.
Hinzu kommen umfangreiche Anträge auf Fördermittel von Stiftungen, privaten Initiativen oder Landesprogrammen – oft verbunden mit komplexen Abrechnungs- und Dokumentationspflichten. Die Vereinswelt hat sich professionalisiert, nicht aus Luxus, sondern aus Notwendigkeit. Dass diese Strukturen überhaupt existieren, ist keine Selbstverständlichkeit. Es sind Bürgerinnen und Bürger, die sich in ihrer Freizeit einarbeiten, Verantwortung übernehmen und Verwaltungstätigkeiten leisten, die früher staatlichen Einrichtungen vorbehalten waren. Ohne dieses stille, hartnäckige Engagement wären viele soziale, kulturelle und sportliche Angebote schon längst verschwunden. Gerade deshalb verdient das Ehrenamt nicht nur Dankesworte – sondern auch handfeste Unterstützung.
Ehrenamtliches Engagement in Zahlen – Der stille Reichtum Bensheims
In Bensheim engagieren sich tausende Bürgerinnen und Bürger freiwillig für ihre Stadt. Das Vereinsleben in Bensheim ist außergewöhnlich vielfältig und lebendig. Bundesweit engagieren sich laut Freiwilligensurvey etwa 40 % der Bevölkerung ehrenamtlich. Übertragen auf Bensheim entspricht das rund 16.000 Menschen, die sich regelmäßig für ihre Mitmenschen einsetzen – unentgeltlich und oft weit über das Erwartbare hinaus.
Dieses Engagement bedeutet mehr als nur investierte Zeit: Viele Ehrenamtliche leisten in ihren Vereinen Aufgaben, die andernorts hauptamtlich bezahlt werden müssten – von der Kinder- und Jugendarbeit über Kulturprojekte bis hin zur Organisation von Sportangeboten und Umweltinitiativen. Hinzu kommt, dass Vereine sich heute längst nicht mehr allein auf Mitgliedsbeiträge oder Zuschüsse verlassen können. Sie organisieren Crowdfunding-Kampagnen, sammeln Spenden, gründen Fördervereine, schreiben Förderanträge und übernehmen Verwaltungstätigkeiten, um sich finanziell über Wasser zu halten. Jede Benefizveranstaltung, jedes finanzierte Projekt und jeder Förderantrag kostet dabei nicht nur Aufwand, sondern auch ehrenamtliche Arbeitsstunden, die im Hintergrund oft unbemerkt bleiben.
Würde man diese geleisteten Stunden mit einem fairen, durchschnittlichen Stundenlohn bewerten, käme ein beeindruckender Millionenbetrag zusammen – ein Wert, der den tatsächlichen Beitrag der Vereine und ihrer Mitglieder zur städtischen Lebensqualität widerspiegelt. Diese Zahlen zeigen: Vereine in Bensheim sind nicht nur ideelle Träger des Zusammenhalts, sondern auch wirtschaftliche Leistungsträger, deren Wertschöpfung für die Stadt unbezahlbar ist. Gerade deshalb darf ihre Unterstützung in Krisenzeiten nicht als Kostenfaktor, sondern muss als Investition in das Fundament unserer Gemeinschaft verstanden werden.
Die unterschätzten Folgen eines Rückzugs
Ein vollständiger Rückzug der Stadt aus der finanziellen Unterstützung der Vereinslandschaft hätte nicht nur haushalterische, sondern auch gesellschaftliche Folgen – wenn auch nicht sofort überall sichtbar. Viele Vereine arbeiten sehr eigenständig und stemmen ihre Angebote mit viel ehrenamtlichem Engagement, Kreativität und oft begrenzten Mitteln. Dennoch sind kommunale Zuschüsse für zahlreiche Initiativen ein wichtiger Baustein. Gerade kleinere, spezialisierte oder sozial ausgerichtete Angebote profitieren von dieser Unterstützung – und bei einigen machen schon geringe Beträge den entscheidenden Unterschied zwischen „weiterführen“ oder „einstellen“.
Ein solcher Rückzug wäre daher nicht nur eine Frage der Zahlen, sondern auch ein symbolisches Signal. Wenn die Stadt sich aus der Verantwortung zurückzieht, sendet sie die Botschaft, dass bürgerschaftliches Engagement weniger wertgeschätzt wird. Das kann auf Dauer dem Vertrauen zwischen Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft schaden.
Natürlich würde nicht das gesamte Vereinsleben zum Stillstand kommen – viele Strukturen sind stabil, und die Menschen dahinter engagieren sich aus Überzeugung. Aber die Vielfalt, die Tiefe und auch die soziale Breite könnten spürbar leiden. Angebote für Jugendliche, Kulturveranstaltungen in Nischenbereichen, niedrigschwellige Bewegungsangebote für Ältere oder integrative Projekte für benachteiligte Gruppen wären unter Druck. Letztlich ginge damit auch ein Teil der städtischen Identität verloren – jenes lebendige Miteinander, das den Alltag vieler Menschen bereichert, ohne dass es direkt im Haushalt erkennbar ist.
Vereine entlasten öffentliche Stellen in vielen Bereichen – ob im Sport, in der Kultur, im sozialen Miteinander oder bei der Integration. Ihre Wirkung zeigt sich oft nicht in Zahlen, sondern in stabileren Gemeinschaften, höherer Lebensqualität und mehr sozialem Zusammenhalt. Diese indirekten Effekte gilt es mitzudenken, wenn über Haushaltsentscheidungen diskutiert wird. Eine strategische, verantwortungsvolle Förderung von Vereinen ist keine Luxusausgabe – sie ist eine Investition in das langfristige Funktionieren einer Stadtgesellschaft.
Klug handeln statt kurzfristig sparen
Gerade jetzt braucht es einen klaren Blick auf die Bedeutung der Vereinsarbeit. Sicher: Es wird nicht möglich sein, alle Förderungen in alter Höhe fortzusetzen. Aber ein völliger Rückzug wäre nicht nur unklug – er wäre langfristig teurer. Wer heute Vereinsstrukturen destabilisiert, muss morgen mit höheren sozialen Folgekosten rechnen. Wer heute den Vereinen den Boden entzieht, wird morgen mehr Einsamkeit, mehr soziale Spaltung und weniger bürgerschaftliches Engagement ernten. Deshalb sollten Einschnitte klug und sozial ausgewogen gestaltet werden. Es braucht Maß und Mitte: Förderungen können angepasst, neu priorisiert oder projektbezogen vergeben werden – aber die Grundstruktur der Vereinslandschaft muss erhalten bleiben. Wenn man bei den sozialen Angeboten der öffentlichen Hand den Rotstift ansetzt, sollte man nicht dort sparen, wo Engagement, Zusammenhalt und Prävention mit minimalen Mitteln Großes leisten.
Eine Stadt lebt nicht nur von ihrer Infrastruktur und ihren Steuereinnahmen. Sie lebt von den Menschen, die sie gestalten und tragen. Vereine sind Ausdruck dieses Engagements – freiwillig, unentgeltlich, mit Herzblut. Gerade in Zeiten knapper Kassen zeigt sich, was wirklich zählt. Vereine sind keine freiwillige Kür – sie sind eine tragende Säule unserer Gesellschaft. Es liegt an uns allen – Politik, Verwaltung und Bürger:innen – dafür zu sorgen, dass diese Säule auch in schwierigen Zeiten nicht bricht.
Veröffentlicht im: Bergsträßer Anzeiger, Ausgabe vom 13. Mai 2025, Seite 14
Leserforum zum Thema „Welche Auswirkungen hat die Haushaltslage auf Bensheimer Vereine?“
Diese Diskussion ist in Zeiten knapper Kassen nachvollziehbar, wirft jedoch gleichzeitig eine viel wichtigere Frage auf: Wissen wir eigentlich noch, was unsere Vereine leisten?
Vereine sind weit mehr als Freizeitangebote oder nette Begegnungsstätten – sie sind das Fundament einer funktionierenden Gesellschaft. Was hier tagtäglich an ehrenamtlicher Arbeit geleistet wird, wäre andernorts kaum finanzierbar.
Während über Kürzungen und mögliche Einsparungen diskutiert wird, sollte man sich bewusst machen, dass diese ein Vielfaches an Folgekosten verursachen können. In der Jugendarbeit übernehmen Vereine Aufgaben, die weit über das hinausgehen, was Schulen und städtische Angebote leisten können. Hier findet Prävention statt. Jugendliche werden in ihrer Freizeit begleitet, in Strukturen eingebunden und lernen Werte wie Teamgeist, Verantwortung und soziale Kompetenz. Die Unterstützung durch Ehrenamtliche verhindert nicht nur Perspektivlosigkeit und soziale Isolation, sondern wirkt präventiv gegen Gewalt und Kriminalität. Was passiert, wenn diese Strukturen wegbrechen? Wer fängt die Jugendlichen dann auf?
Auch im Bereich der Seniorenarbeit sind Vereine oft die einzige Brücke zur Gesellschaft. Gemeinsame Aktivitäten sorgen dafür, dass ältere Menschen nicht vereinsamen. Hier wird soziale Integration gelebt – Woche für Woche, oft ganz unscheinbar, aber mit großer Wirkung. Die Alternative? Einsamkeit, Isolation und letztlich höhere Kosten für soziale Dienste, die diese Lücke zu schließen versuchen.
Darüber hinaus leisten Vereine einen enormen Beitrag zur Förderung demokratischer Werte. Hier werden Werte vermittelt, die unsere Gesellschaft im Kern ausmachen: Fairness, Toleranz, gegenseitiger Respekt und der Umgang mit Verantwortung. Viele Vereine erarbeiten gemeinsam Leitbilder, fördern den Dialog und stärken das Verständnis für gesellschaftliches Miteinander. Diese gelebten Werte sind nicht nur prägend für junge Menschen, sondern ein essenzielles Element unserer Zivilgesellschaft.
Die Präventionsarbeit der Vereine ist unbezahlbar. Ob Gesundheitsförderung durch Sportangebote, Umweltbildung oder die Schaffung sozialer Netzwerke. All diese Maßnahmen verhindern langfristig soziale und gesundheitliche Folgekosten. Hier wird investiert, bevor es teuer wird.
Gerade in einer Stadt wie Bensheim, die mit erheblichen finanziellen Herausforderungen zu kämpfen hat, stellt sich die Frage nach Vereinsförderung ganz anders. Es geht nicht um einfache Zuschüsse, es geht um Investitionen in gesellschaftliche Strukturen, die an anderer Stelle teure soziale Maßnahmen überflüssig machen. Wenn man bei den sozialen Angeboten der öffentlichen Hand den Rotstift ansetzt, sollte man nicht dort sparen, wo Engagement, Zusammenhalt und Prävention mit minimalen Mitteln Großes leisten. Vereine sind die Orte, an denen Gemeinschaft entsteht, Werte gelebt und Perspektiven geschaffen werden. Gerade in Krisenzeiten wäre es fatal, diese Säulen des Zusammenhalts zu schwächen. Die Frage sollte also nicht sein, wo man kürzen kann, sondern wie man diese Strukturen ausbauen und stärken kann.
Was wäre, wenn die Stadt Bensheim nicht fragte, was sie einsparen kann, sondern was sie bereit ist, zusätzlich zu investieren, um diese wertvollen Leistungen weiter zu fördern? Was wäre, wenn wir den Gedanken umdrehen und erkennen, dass jede Investition in unsere Vereine nicht nur Kosten spart, sondern vor allem Zukunft sichert?
Michael K. Kärchner▶ Mein Leserbrief im Bergsträßer Anzeiger vom 13. Mai 2025
Bensheim
Wie hat Dir der Artikel gefallen?
Zuletzt aktualisiert am 23. Mai 2025
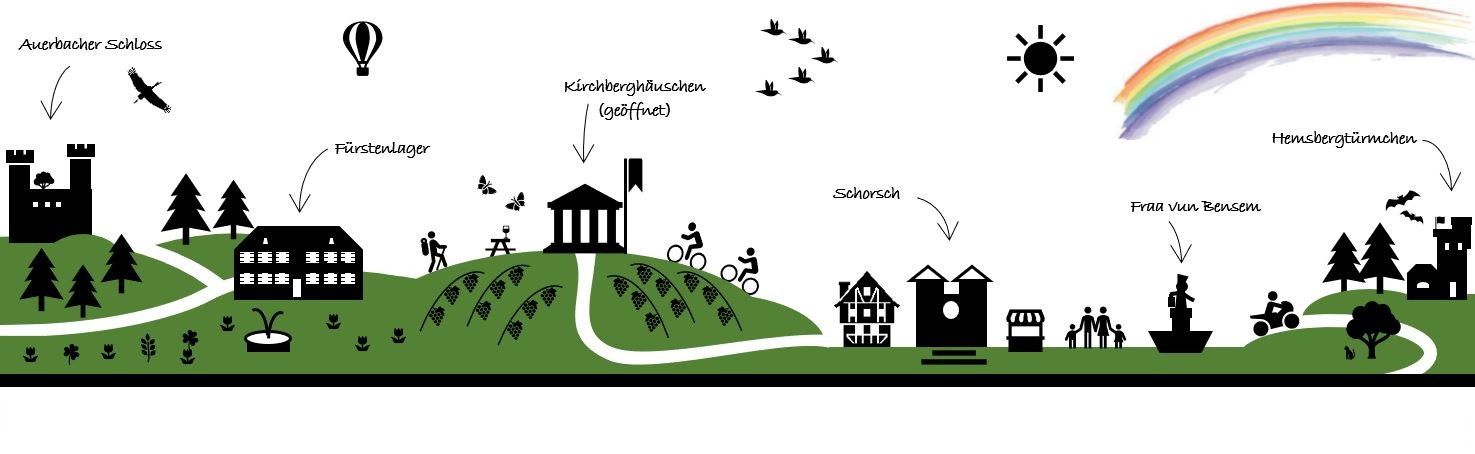

















Sehr gut geschrieben und total richtig.